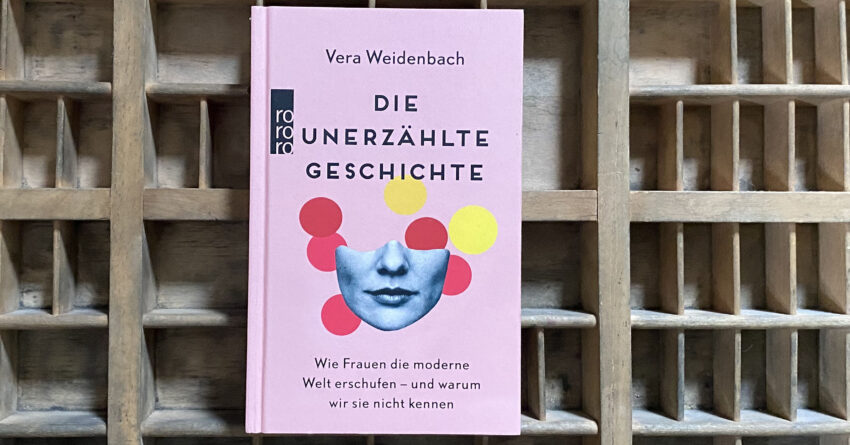Mit Vera Weidenbach habe ich mich über ihr Buch „Die unerzählte Geschichte – Wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen“ unterhalten. Darin erzählt sie anhand vieler Beispiele und Portraits welchen Anteil Frauen an unserer modernen Welt haben und verdeutlicht Strukturen und Mechanismen herkömmlicher Geschichtsschreibung, die vor allem eines sind: Männlich geprägt. Warum das so ist und warum Frauen aus der Geschichte allzu oft einfach „verschwunden“ sind, obwohl sie großartige Erfindungen gemacht, Literatur und Kunst geschaffen haben oder Politikerinnen waren, hat mir Vera erklärt.
Ausgangspunkt deiner Ausführungen ist das 19. Jahrhundert? Warum?
Das 19. Jahrhundert ist der Beginn der westlichen Moderne, der Anfang unserer Zeit und Gegenwart. Wir können uns damit identifizieren. Außerdem ist das 19. Jahrhundert als Zeitpunkt und Zeitspanne noch nicht so lange weg, als dass wir nichts mehr damit anfangen könnten. Zeitlicher Schlusspunkt im Buch ist die Eröffnung des Europaparlaments im Jahr 1979. Da haben zwei französische Politikerinnen, deren Geschichte auch im Buch erzählt wird, eine wichtige Rolle gespielt. Louise Weiß verkündete damals als Alterspräsidentin die Wahl der ersten Präsidentin des Parlaments, Simone Weil und übergab ihr den Chefinnensessel.
Was war der Auslöser, dich intensiver mit Mechanismen und Strukturen von Geschichtsschreibung auseinanderzusetzen?
In erster Linie Unbehagen. Auf Städtetrips ist mir zum Beispiel immer aufgefallen, dass es Statuen und Denkmäler, meist nur von berühmten Männern gibt. Ich habe mich zu fragen begonnen: War das wirklich so? Gab es da keine Frauen, die man hier nennen könnte? Woran liegt das? Lag es wirklich an den Frauen? Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir das Ausmaß dieser Geschichts-Umdeutung bewusst geworden. Ich habe mich beim Recherchieren teilweise wie Neo im Film „Matrix“ gefühlt, als ihm das Ausmaß des riesigen Betrugs, der Simulation bewusst wird, in der er lebt. Es gibt so viele Beispiele, wo Frauen Erfinderinnen, Autorinnen, Politikerinnen etc. waren, die historische Überlieferung dies aber ausblendet, verschweigt oder vergisst. Mir war es daher wichtig, im Buch ganz konkret Frauen nennen, die großartige Leistungen erbracht haben, die in der Überlieferung aber teilweise Männern zugeschrieben werden. Andererseits wollte ich auch den systemischen Charakter beschreiben, den dieses Nicht-Nennen von Frauen hat.
Warum ist das so? Welche Mechanismen und Strukturen der Manipulation gibt es?
Das sogenannte kulturelle Gedächtnis ist ein männliches Gedächtnis, dieses ist von Männern geprägt und erinnert auch überwiegend an Männer. Ich habe in meinem Buch vor allem drei Mechanismen hervorgehoben: Das klassische Verschwinden-Lassen. Frauen, die zu ihren Lebzeiten bekannt und berühmt waren, wurden im Nachhinein, im Kanon der Geschichte weggelassen. Gängig ist leider auch die Rekategorisierung, wo Männer die Arbeit von Frauen für ihren eigenen Erfolg genutzt haben und im geschichtlichen Gedächtnis ihr Name und nicht der, der urhebenden oder mitwirkenden Frau übrigbleibt. Oder dann das Phänomen der Zweiklassengeschichte, wo Frauen nicht wirklich für ihre Leistungen, sondern als Frau erinnert werden. Es wird ihnen das Etikett verpasst, dass sie denken oder schreiben könnten wie Männer, aber nicht wie Frauen. Wir kennen auch die absoluten Ausnahmen – man denke etwa an Jeanne d´Arc oder Marie Curie. In der Geschichte sind sie so etwas wie „Quotenfrauen“. Sie sind so außerordentlich, dass sie nicht normal sein können. Sie zementieren das Bild, dass Frauen, die es in den Kanon der Weltgeschichte schaffen keine „normalen“ Frauen sind, also etwas, das natürlicherweise nicht vorkommt. Dieses Bild ist eine Verzerrung und falsch.
Welche Frauen haben dich besonders fasziniert?
Sie sind alle faszinierend. Es gibt so viele Beispiele für Frauen, die Großes geleistet haben: So wurde etwa das erste Computerprogramm von der britischen Mathematikerin Ada Lovelace geschrieben oder trug Biochemikerin Rosalind Franklin maßgeblich dazu bei, die Struktur der DNA zu beschreiben. Den Nobelpreis für diese bahnbrechende Entdeckung haben aber James Watson und Francis Crick bekommen. Ein weiteres Beispiel ist Physikerin Lise Meitner, die zusammen mit Otto Hahn die Kernspaltung entdeckt hat. Auch in Kunst und Kultur gibt es zahlreiche Beispiele, wie Frauen aus der Geschichte und Rezeption getilgt wurden: Etwa Schriftstellerin Margarete Steffin, die in der Forschungsliteratur zumeist als Mitarbeiterin Bertolt Brechts genannt wird, jedoch die Co-Autorin zahlreicher Brecht-Stücke war. Weiters die französische Bildhauerin Camille Claudel, die die Bildhauerei der Moderne prägte. Oder Lotte Reiniger, die gut 20 Jahre vor Disney, im Berlin der 1920er-Jahre ersten Trickfilme schuf …
Wo hast Du recherchiert?
Ich habe klassische Literaturrecherche gemacht und war auch viel in Archiven. Außerdem sind mir immer öfter Beispiele untergekommen, wo Historie leider auch heute noch immer nicht korrekt vermittelt wird. Oft auch von offizieller Seite. Bei meiner Recherche ist außerdem ein richtiger „Schneeball-Effekt“ in Gang gekommen: Sensibilisiert für das Thema habe ich immer mehr entdeckt oder haben mich Bekannte und Kolleg*innen immer wieder auf interessante Frauen aufmerksam gemacht, da ist eine richtige Dynamik entstanden.
Was ist Dir bei der Vermittlung von Geschichte wichtig?
Geschichtsschreibung ist politisch. Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wer die Geschichte erzählt und ob oder was damit bezweckt werden soll. Ich bin überzeugt, dass unsere Welt anders aussehen würde, wenn wir Geschichte anders erzählen würden. Auch der Aspekt sogenannter Normgeschichtlichkeit unterstützt konstruierte Geschichtsschreibung: Minderheiten – von Frauen über Leute der LGBTQ-Community bis hin zu POC – sind in der Geschichtsvermittlung der westlichen, weißen Welt oft ausgeklammert. Mir geht es auch hier darum, Bewusstsein zu schaffen. Prozesshafter zu denken, als Geschichte an einzelnen Personen festzumachen, denn ich finde auch den Helden- und Geniebegriff grundsätzlich schwierig. An großen Errungenschaften oder Geschehnissen sind immer mehrere Menschen beteiligt, diese Vielfalt sollte auch über Geschichtsschreibung transportiert werden.
Hast Du bei deinen Recherchen mal richtig schmunzeln müssen?
Ja, da gab es tatsächlich öfter Momente, wo ich lächeln musste. Etwa als ich die Tagebuchnotizen von Ärztin und Psychoanalytikerin Sabine Spielrein oder Chemikerin Clara Immerwahr las: Da waren so viele Fragen und Überlegungen enthalten, die uns als Frauen auch heute noch umtreiben. Fragen nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Fragen nach weiblicher Unabhängigkeit. Obwohl diese Notizen im 19. Jahrhundert verfasst wurden, haben sie erstaunliche Aktualität. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch etwas schmerzhaft, weil sich bis heute so wenig geändert hat.
Was wünscht Du dir für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass die kritischen Stimmen hier lauter werden und eine richtige Grassroot-Bewegung entsteht. Wir brauchen einen ausgewogenen Geschichtskanon und noch wichtiger, wir als Frauen brauchen Vorbilder. Mit dem Bewusstsein, wie viele tolle Frauen es gab, auf deren Schultern wir stehen dürfen, können wir als Frauen souveräner agieren. Und das macht Mut.
Vera Weidenbach, Die unerzählte Geschichte. Wie Frauen die moderne Welt erschufen – und warum wir sie nicht kennen, Hamburg: Rowohlt Verlag, 2022.