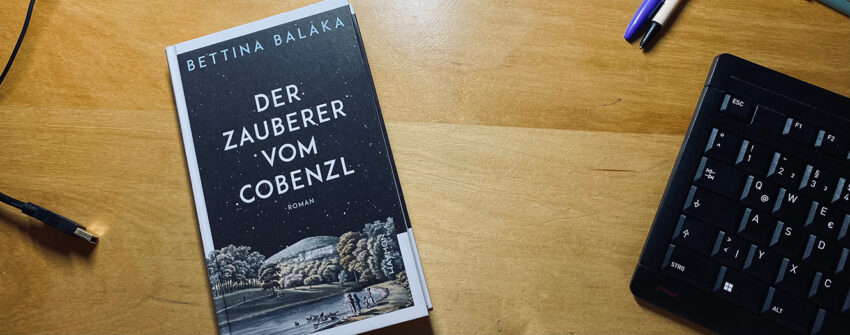In ihrem Roman „Der Zauberer vom Cobenzl“ zeichnet Bettina Balàka die Lebensgeschichte zweier Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein können: Hermine ist der Naturwissenschaft zugetan, Ottone der Musik und Kunst. Im Schatten ihres von Wissensdrang und Wissenschaft getriebenen Vaters, dem einst erfolgreichen Industriellen und Wissenschaftler Carl Ludwig Freiherr von Reichenbach bahnen sich die beiden den Weg aus ihrem goldenen Käfig. In der Zeitkulisse des 19. Jahrhunderts, mit Schauplätzen in Blansko in Mähren und Wien, entführt „Der Zauberer vom Cobenzl“ in eine geheimnisvolle Welt und gibt Einblick in eine berührende Familiengeschichte. Clärchen hat Autorin Bettina Balàka zu Recherche-Quellen und persönlichen Zugängen bei der Arbeit an „Der Zauberer vom Cobenzl“ befragt.
Welche Zeit-Stimmung möchten Sie im „Der Zauberer vom Cobenzl“ vermitteln? Welche Parallelen gibt es zur Gegenwart?
An der Person Carl Ludwigs von Reichenbach zeigt sich der Weg eines Menschen, der nach spektakulären Erfolgen bei der Revolutionierung der Holzverkohlung und des Eisengusses in eine Sackgasse gerät, indem er den Weg der exakten Wissenschaften verlässt. Das von ihm vermeintlich entdeckte Od (eine alles durchdringende Lebenskraft) ist objektiv nicht messbar, sondern nur durch besonders begabte Menschen, sogenannte „Sensitive“ zu schauen und zu spüren. Dieser Versuch, Menschen als Messgeräte zu verwenden, kostet Reichenbach schließlich seine wissenschaftliche Reputation. Das Thema ist aber keineswegs beendet, gerade während der Pandemie konnte man sehen, wie Wissenschaft angezweifelt wurde, gerade weil sie ihre Annahmen stetig an neue Erkenntnisse anpasst und somit keine ewigen Wahrheiten postuliert. Dagegen ist die Homöopathie, die zu Reichenbachs Zeit aufkam und von ihm paradoxerweise strikt abgelehnt wurde, heute noch in jeder Apotheke zu finden.
Was fasziniert Sie persönlich am 19. Jahrhundert? Wie näherten Sie sich dem zeitlichen Kontext in Ihren historischen Recherchen für das Buch „Der Zauberer vom Cobenzl“ an?
Im 19. Jahrhundert begannen jene Entwicklungen, die für unser heutiges Leben prägend sind. Am Anfang stand die Industrialisierung – am Ende stehen Klimakrise, Umweltzerstörung und Artensterben. Von der Erleichterung des Reisens mit Hilfe von Eisenbahn und Dampfschiff führt eine direkte Linie zu Übertourismus und Zerstörung des Alltags an den schönsten Orten der Welt. Mich interessiert es, wie die Menschen, die an der Schwelle zu diesen gravierenden Veränderungen dabei waren, gelebt haben. Empfanden sie schon den Verlust, der mit dem Fortschritt einherging? So wird etwa in meinem Roman die für die Mädchen Ottone und Hermine verzauberte Wiese am Ufer der Zwittawa für ein neues Fabriksgebäude geopfert …
Was war Ihnen bei Sprache und Charakterzeichnung der Figuren wichtig? Was würden Sie in Sprache und Charaktergestaltung als zeitgenössisch „typisch“ erachten? Wo haben Sie zur Sprache der Figuren recherchiert?
Ein Gefühl für die Sprache der Zeit zu bekommen ist, da es ja keine Tonaufnahmen gibt, nur durch Lesen möglich. Publiziert wurde ja schon viel, von Literatur über Sachbücher bis hin zu Zeitungen und Zeitschriften. Streckenweise hatte ich mich so vertieft, dass meine Familie meinte, ich würde mich neuerdings „sehr gewählt“ ausdrücken. Im „Zauberer vom Cobenzl“ habe ich jedoch nicht versucht, diese Sprache zu imitieren, nach den Kriterien des heutigen Geschmacks würde man sie auch als viel zu weitschweifig und pathetisch empfinden. Ich habe eine fiktionale Sprache des 19. Jahrhunderts entworfen, markiert durch Elemente jener Zeit, die aber modern interpretiert sind – vielleicht so, wie die Wiener Modedesignerin Susanne Bisovsky, die alte Trachten zeitgenössisch interpretiert. Dabei gibt es durchaus Missverständnisse: Ein Kritiker meinte etwa, ich hätte mit der Verwendung des Wortes „Erdarbeiterinnen“ gegendert, dabei ist das in alten Dokumenten genauso zu finden…
Bettina Balàka, Der Zauberer vom Cobenzl. Innsbruck & Wien: Haymon Verlag, 2023.